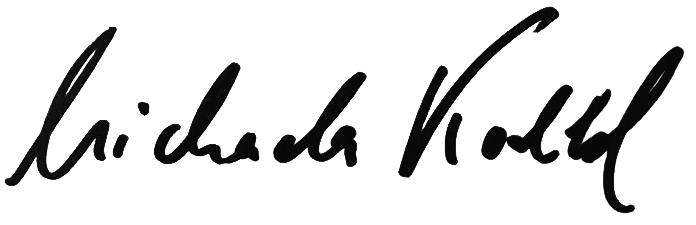Alles fing so gut an und endlich schien es so als hätte man DIE LÖSUNG für beinahe jedes Pferdeproblem gefunden.
Die Rede ist von „Spielen“, die dem Pferd lehren sollen auf minimalen Druck (nachher sind es nur noch Zeichen) vorwärts, rückwärts, seitwärts zu weichen, die Vorhand und die Hinterhand zu verschieben und das alles nach Möglichkeit auf Kommando.
Der weitaus wichtigere Grund für diese Spiele soll der Vertrauensgewinn sein, der sich mit zunehmender Raffinesse und Übung einstellen soll.
Und genau diesen Punkt möchte ich eingehender beleuchten: einem Pferd beizubringen um einen herumzulaufen ohne einem die Longe aus der Hand zu reißen oder permanent in die Mitte zu kommen ist ohne Zweifel eine gute Sache. Wer würde das in Frage stellen. Auch ist es besonders für den späteren Verlauf des Trainings von Vorteil, wenn sich die einzelnen Körperteile des Pferdes ohne großen Aufwand bewegen lassen und es lernt in stressigen Situationen cool zu bleiben.
Und hier genau vergaloppiert sich die so anfangs gut gemeinte Idee. Was als Vorbereitung auf das Reiten und als Korrektur von Problempferden gedacht war, entwickelt sich immer mehr zu einem Selbstzweck, bei dem das Pferd zum Spielball seiner übereifrigen Besitzer wird.
Die Technik wird perfektioniert, die „Games“ werden gedrillt und wir machen uns Glauben, dass unser Pferd uns jetzt wirklich vertraut. Dabei sind wir meilenweit von einer echten Beziehung zu unserem Tier entfernt. Wenn wir uns nur trauen würden genau hinzuschauen und unser Gefühl zu fragen, wäre uns binnen kürzester Zeit klar, dass wir uns in einer Sackgasse befinden. Wir würden erkennen, dass unserem Pferd die gut gemeinten Spiele zum Hals raushängen. Wir würden seinen toten Zombie-Blick erkennen, die angelegten Ohren, das Schweifrudern, die mangelnde „Freude“ und die Unlust, mit der unsere Programme ausgeführt werden. Um es mit den Worten von Berthold Brecht zu sagen: “Und so sehen wir betroffen / Den Vorhang zu und alle Fragen offen.“
Es ist nicht meine Absicht auch nur irgend jemandem seinen Spaß am Pferd zu nehmen, oder ihn daran zu hindern mit seinem Pferd zu arbeiten. Was ich beklage ist ein Trend, der besonders in der europäischen Horsemanship Szene zu beobachten ist.
Ich rede von einer Bewegung, die das Horsemanship, so wie es eigentlich gemeint war, ad absurdum führt. Kein Horseman der alten Schule würde auf die Idee kommen mit sein
Kein Horseman der alten Schule würde auf die Idee kommen mit seinem Pferd zu spielen. Er fühlt sein Pferd, liest sein Pferd, stellt ihm Fragen und hilft ihm. Ganz nebenbei bringt er ihm bei um ihn herumzulaufen, seine Schulter zu verschieben, seine Hinterhand zu bewegen, anzuhalten und evtl. etwas rückwärts zu gehen. All dies geschieht ohne großen Aufhebens. Und noch etwas ist sehr auffällig. Wenn der Horseman weiß, dass sein Pferd seine Lektion verstanden hat, wird sie nur abgefragt, wenn es einen guten Grund dafür gibt.
Was ist nun bei dem Horsemanship wie es bei uns vorherrscht schief gelaufen?
Horsemanship bedeutet für mich soviel wie Freundschaft mit dem Pferd. Unter Freundschaft verstehen wir eine Beziehung zwischen 2 Persönlichkeiten, die auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen basiert.
Natürlich wollen wir als Pferdebesitzer, dass unsere Pferde uns respektieren und uns vertrauen. Klar! Und darum tun wir alles, was uns möglich ist, dies auch zu erreichen. Wir scheuchen unsere Pferde um uns herum, links, rechts, auf Fingerzeig rückwärts, erarbeiten uns fast perfekte Seitengänge mit uns ohne Stick und sind stolz wie Oskar, wenn uns das Pferd wie ein Hund hinterherläuft. Zugegeben: auf den ersten Blick sieht das auch sehr beeindruckend aus, bei genauerem Hinsehen jedoch offenbaren sich Abgründe, die zu Beginn gerne als harmlose zu vernachlässigende Signale übersehen werden.
Wer denkt sich schon etwas dabei, wenn das Pferd nicht mehr so frisch reagiert, nachdem man ihm das abc schon zum x-ten Mal entlockt hat? Wer fragst sich ehrlich ob z.B. übermäßiges Stolpern oder ein unreiner Takt vielleicht etwas mit unseren Spielen zu tun haben könnte? Wer ist überhaupt darauf geschult zu erkennen, wenn sich sein Pferd mental verschließt?
Wir reagieren erst, wenn das Pferd uns deutlich zu verstehen gibt, dass etwas nicht stimmt. Wenn es die Ohren anlegt, den Kiefer festhält, mit dem Schweif rudert, wissen wir, dass Holland in Not ist.
Weil wir aber meist immer noch nicht unsere vorherigen Aktionen mit den mitunter sehr heftigen Reaktionen unsere Pferde in Verbindung bringen, sieht unsere Interpretation nicht selten wie folgt aus: „es ist respektlos wie sich mein Pferd verhält. Es ist nicht präsent, passt nicht auf und zeigt aggressives Verhalten mir gegenüber. Ich werde ihm deutlich machen, dass ich diese Art von Reaktionen nicht schätze und erwarte von ihm, dass er seine Lektionen ohne Widerstand ausführt. Schließlich kann er sie ja!“
Und genau HIER liegt der Hase im Pfeffer! Weil mein Pferd die Aufgaben ja kann (es kann sie im Prinzip im Schlaf rauf -und runterbeten), ist es so genervt!
Ich versuche gerade herauszufinden welchen Nutzen unser Pferd aus unseren Spielen hat. Den Spaß, den wir ihm gerne unterstellen wollen, hat es sicher nicht.
Der einzige Grund warum unser Pferd gute Miene zum bösen Spiel macht, ist sein Respekt vor uns.
Chapeau! Wenn das nicht ins Schwarze trifft. Dann ist doch alles gut, oder? Nein, eben nicht! Wer zollt dem Pferd denn Respekt? Wäre das nicht eigentlich unser Part? So wie wir unser Horsemanship ausüben, erinnert es eher an ein „Dictatorship“ als an ein „Partnership“.
Wenn wir nur halb so viel Respekt vor unseren Pferden hätten wie umgekehrt, würden wir endlich aufhören mit ihnen zu spielen und versuchen es den wahren Horsemen gleichzutun. Wir würden unsere Pferde nicht unnötig Dinge abfragen, die längst gegessen sind. Wir würden nicht permanent nach Beweisen ihres Wissens fordern, wenn wir unser eigenes Misstrauen zum Schweigen bringen könnten.
Wir fordern Respekt und Vertrauen von unseren Pferden und sind selbst voller Respektlosigkeit und Misstrauen ihnen gegenüber.
Das ist der beste Weg vom Horsemanship zum Horsemanshit!
Um es noch einmal zu betonen: ich rede von Pferdebesitzern und Trainern, die ihre Pferde wie Marionetten an ihren Fäden tanzen lassen und nicht im Entferntesten ein Gefühl für die Persönlichkeit und die Duldsamkeit ihrer vermeintlichen Partner haben. Ich rede von denen, die kein Timing haben und ihre Lektionen als Selbstzweck für ihr schwaches Ego missbrauchen.
Mein Appell an alle Pferdebesitzer:
lasst Eure Pferde Pferde sein. Nehmt ihnen nicht ihre Würde und zollt ihnen Respekt. Vertraut ihnen, dass sie Dinge verstehen bevor Ihr sie ausgesprochen habt. Behaltet Euer Ziel im Auge und hört auf, wenn es gut ist. Wenn Ihr das beachtet, werdet Ihr eine natürlich entspannte Beziehung zu Eurem Pferd haben, die auf gegenseitigem Respekt und Anerkennung basiert.